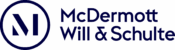Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit unabhängig vom Geschlecht ist nicht nur ein rechtspolitisches Ziel, sondern über §§ 3, 7 EntgTranspG sowie Art. 157 AUEV ein verbindlicher Rechtsanspruch. Lediglich die Umsetzung dieses Anspruchs bereitet in der Praxis regelmäßig Probleme. Im Vergleich zu männlichen Beschäftigten verdienen weibliche Beschäftigte für vergleichbare Arbeit jedenfalls im Durchschnitt noch immer weniger Gehalt.
Prozessual bietet § 22 AGG Beschäftigten sowohl den Vorteil einer erleichterten Darlegungslast als auch einer Beweislastumkehr. Die klagende Partei muss danach lediglich Indizien darlegen und im Streitfall beweisen, die eine Diskriminierung wegen des Geschlechts vermuten lassen. Sodann obliegt es dem Arbeitgeber, diese Vermutung zu widerlegen.
Korrespondierend bietet das Entgelttransparenzgesetz seit 2017 Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitenden einen individuellen Auskunftsanspruch. Dieser ist auf die Angabe des Medians des Vergleichsentgelts gerichtet. Auf diese Weise können Beschäftigte Informationen über Kriterien zur Entgeltfestsetzung und den Medianverdienst vergleichbarer Kolleginnen und Kollegen eines anderen Geschlechts einfordern. Praktisch ist das Benennen der korrekten Vergleichsgruppe hier aber nicht ganz einfach.
Das Ziel des Gesetzes besteht darin, Entgeltgerechtigkeit und Transparenz zu fördern, indem die Mitarbeitenden erfahren können, ob sie weniger für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit verdienen. Allerdings sieht das EntgTranspG über den Auskunftsanspruch hinaus keine eigenständigen Zahlungsansprüche vor. Insbesondere regelt das Gesetz nicht ausdrücklich die Rechtsfolgen, die Beschäftigte aus den erlangten Informationen herleiten können.
Medianwert als Maßstab
Nach der bisherigen Rechtsprechung der Arbeitsgerichte begründete der Umstand, dass eine Arbeitnehmerin ein geringeres Entgelt als das Medianentgelt der männlichen Vergleichsperson(en) erhält, die (widerlegbare) Vermutung einer Entgeltbenachteiligung wegen des Geschlechts (BAG v. 21. Januar 2021 – 8 AZR 488/19).
Das Medianentgelt ist der Wert, der genau in der Mitte liegt, wenn alle Zahlen der Reihe der Größe nach sortiert sind – die Hälfte ist kleiner, die andere Hälfte größer. Der Nachteil dieser Vergleichsmethode ist, dass der Medianwert die tatsächliche Entgeltstruktur nur eingeschränkt abbilden kann, da er keine Auskunft über die Spannweite oder Verteilung der Gehälter ergibt. Das führt dazu, dass erhebliche Unterschiede innerhalb einer Vergleichsgruppe hierdurch verdeckt bleiben.
BAG setzt auf Paarvergleich
Mit der Frage, ob diese Vermutungswirkung auch eintritt, wenn die betroffene Arbeitnehmerin sich nicht auf den über den Auskunftsanspruch nach § 10 EntgTranspG erlangten Medianwert bezieht, sondern auf das ihr bekannte Gehalt eines konkreten männlichen Kollegen, musste sich jüngst das Bundesarbeitsgericht befassen.
In dem vom BAG zu entscheidenden Fall hat eine Arbeitnehmerin der mittleren Führungsebene der Daimler Truck AG rückwirkend finanzielle Gleichstellung eingeklagt. Ihr Gehalt unterschritt in dem relevanten Zeitraum das jeweilige Medianentgelt beider Geschlechter in der maßgeblichen Führungsebene. Die Besonderheit des Falles: Die Betroffene orientierte sich dabei nicht an ebendiesen Medianwerten, sondern am Gehalt eines Spitzenverdieners in der Gruppe der männlichen Abteilungsleiter.
Die Vorinstanz (LAG Baden-Württemberg v. 1. Oktober 2024 – 2 Sa 14/24) gestand der Klägerin ein höheres Arbeitsentgelt zwar zu, allerdings nur in Höhe der Differenz der Medianentgelte der männlichen und weiblichen Vergleichsgruppe. Für die Vermutung einer Entgeltbenachteiligung genüge es nicht, sich auf eine einzige Vergleichsperson des anderen Geschlechts zu berufen. Angesichts der Größe der männlichen Vergleichsgruppe und der Medianentgelte beider vergleichbarer Geschlechtergruppen bestehe keine überwiegende Wahrscheinlichkeit [...]
Continue Reading